Die Beratungsstelle Stop-Stalking eröffnete am 23.04.2008, knapp ein Jahr, nachdem der § 238 StGB, das Nachstellungsgesetz in Kraft getreten ist.
Stop-Stalking besteht aus einem Team von neun Mitarbeiter*innen. Das Team setzt sich aus Psychologischen Psychotherapeuten und Sozialarbeitern/ Sozialpädagogen zusammen. Das Team wurde zum Thema Stalking geschult und hat an Fortbildungskursen teilgenommen.
KOOPERATIONSPARTNER
- Die Berliner Polizei
- Weisser Ring e.V.
- Rechtsanwälte
- Stalking-Opferhilfe Berlin e.V.
- BIG, Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt
- Männerberatungsstellen
- Frauenberatungsstellen
Stop-Stalking ist ein Angebot von selbst.bestimmt e.V., Fachstelle für Konfliktberatung und Gewaltprävention.
Mitglied im DPW.
Gefördert von
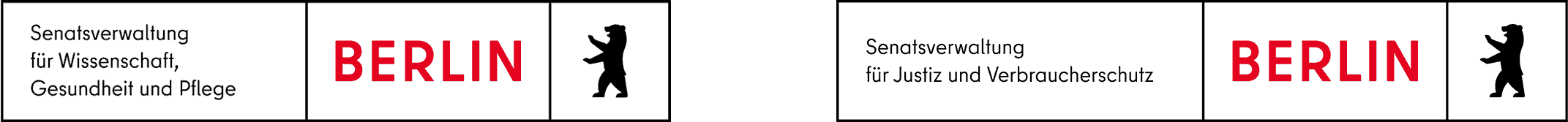
Team
Stop-Stalking besteht aktuell aus einem Team von neun Mitarbeiter*innen. Unsere Berufsfelder sind Psychologische Psychotherapie, Psychologie, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit. Alle verfügen über fundierte Beratungskenntnisse und unterschiedliche therapeutische Zusatzausbildungen.
Wissenschaftlicher Beirat von Stop-Stalking
Der Wissenschaftliche Beirat gibt Empfehlungen für konzeptionelle Umsetzungen und berät Stop-Stalking bei praxisbegleitenden wissenschaftlichen Fragestellungen.
Die Mitglieder des Fachbeirats von Stop-Stalking sind:
- Dipl. Psych. Silvia Cardini (Psychologischer Dienst der JVA Tegel)
- Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas Heinz (Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité)
- Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner (Professorin für Klinische Psychologie und Sozialarbeit, Beratung und Therapie an der Alice Salomon Hochschule Berlin)
- Katharina Seewald (Psychotherapist in training bei Forensic Psychiatric Hospita)
- Prof. Dr. Sandra Wesenberg (Gastprofessorin für Klinische Psychologie mit den Schwerpunkten Beratung und Therapie an der Alice Salomon Hochschule Berlin)
- Prof. Dr. Christian Paulick (Professor für Sozialarbeitswissenschaft/Beratung im Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur an der Hochschule Merseburg)
Kurzkonzept der integrierten Täter-Opfer-Beratung (iTOB)
Die komplexe Dynamik eines Stalking-Geschehens lässt sich oftmals nur erfassen, wenn beide Seiten gesehen werden. Dem gemeinsamen Berater*innen-Team für die stalkende wie auch die gestalkte Person gelingt eine Perspektivenverschränkung, die spezifische Realitätsverzerrungen auf Opfer- wie auf Täterseite erkennen und daraus angemessene Interventionen ableiten kann.
- Oberste Prioritäten sind der Schutz und die Stabilisierung des betroffenen Menschen.
- Oberstes Ziel ist die raschest mögliche Beendigung des Stalking-Verhaltens.
- Wichtigste Voraussetzung hierfür ist die strikt getrennte Beratung, so dass sich die betroffene Person und der Mensch, der stalkt, nie im Rahmen der iTOB begegnen.
Die integrierte Täter-Opfer-Beratung bietet wichtige Vorteile für die Arbeit mit beiden Seiten:
- Das Opfer kann gezielter beraten werden, wenn man durch fortlaufenden Kontakt mit der Täterseite deren Vorgehens- und Erlebensweisen kennt. Bei Bedarf können rasche Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
- Der Mensch, der stalkt, kann besser konfrontiert werden, wenn die Berater auch von der Betroffenenseite Informationen über Fortschritte bzw. Rückfälle des Stalkingverhaltens bekommen.
- Auf beiden Seiten erfolgte Kränkungen können gewürdigt werden, Bagatellisierungen kann konfrontativ begegnet werden, unangemessene Befürchtungen können – ebenso wie unterschätzende Verharmlosungen – korrigiert werden. Die möglichen Ambivalenzen auf beiden Seiten (Nähe- und Distanzwünsche, Idealisierung und Abwertung, Aggression und Schuldgefühle) sind aus der Kenntnis der vorhergehenden Beziehungsdynamik bzw. biographischen Vorerfahrungen besser zu verstehen und individuell aufzuarbeiten.
- Bei eskalierten Trennungskonflikten mit gemeinsamen Kindern und Auseinandersetzungen über die Sorgerechts- und Umgangsregelungen müssen das Kindeswohl, berechtigte Elterninteressen vs. Instrumentalisierung der Kinder für Stalkingoptionen gegeneinander abgewogen werden. In Kooperation mit Jugendamt, Familiengerichten, ggfs. Umgangsbegleitung und anderen beteiligten Einrichtungen wird getrennte Beratung (i.d.R. unter Wahrung der Schweigepflicht) vorgehalten.
Das Vorgehen
- Getrennte Beratung für Stalker*innen und Betroffene im gemischtgeschlechtlichen Berater*innen-Team.
- Angepasste Schutzmaßnahmen für das Opfer durch zeitliche und ggfs. räumliche Trennung der Beratungen.
- Schutzerklärung seitens des Täters/der Täterin für das Opfer, perspektivisch auch für Polizei und Staatsanwaltschaft.
- Bei Zuweisung über die Amtsanwaltschaft erfolgt eine Rückmeldung über den Verlauf, bei Abbruch der Beratung Wiedereinsetzen der Strafverfolgung, bei erfolgreichem Abschluss Chance auf Strafnachlass für den Täter/die Täterin.
- Unverzügliche Rückmeldung an das Opfer, falls Beratung seitens des Täters/der Täterin abgebrochen wird, fortlaufende Risikoanalyse, die in das Bedrohungsmanagement einfließt.
- Schutzmaßnahmen für das Opfer, Bearbeiten der psychischen Belastungen aus dem Stalking (Verletzungen, Ängste, Schlafstörungen, Selbstwertproblematik, ggfs. post-traumatische Belastungssymptome).
- Erarbeiten der Stalking-Dynamik mit dem Täter/der Täterin als fehlangepasste Bewältigung von Kränkung, Erarbeiten von Opfer-Empathie, Auseinandersetzung mit dem Tatverhalten, Unterstützung bei Verhaltenskontrolle und Einstellungsänderung, Entwicklung von Verhaltensalternativen, Stärkung von Ressourcen und Neuorientierung.
Die Vorteile
- Dem Täter/der Täterin werden sofort Grenzen gesetzt, die Sicherheit des Opfers wird bestmöglich gewährleistet, das Opfer wird in der Bearbeitung gestärkt.
- Beschleunigtes Unterbrechen der Stalkingdynamik hilft dem Opfer und nützt dem Täter/der Täterin, denn es vermeidet Chronifizierung (Sekundärprävention) und Strafverfolgung.
- Strafverfolgungsbehörden werden entlastet, Kosteneinsparung bei Polizei, Justiz und im Gesundheitswesen sind möglich.
- Vollständigeres und ausgewogeneres Bild für die Berater*innen, sobald beide Seiten gesehen werden. Somit können Wahrnehmungsverzerrungen aus der jeweiligen Position (Opfer-Täter*in) leichter bearbeitet werden und auf eine Deeskalation hingearbeitet werden.
- Bei familienrechtlichen Auseinandersetzungen werden im Sinne des Kindeswohls die Opfer geschützt, die Täter*innen erhalten Hilfe das Stalking zu beenden. Stalking-Expertise wird für die Jugendhilfe vorgehalten.
Kooperationspartner*innen von Stop-Stalking sind:
Servicestelle Wegweiser: Proaktiver Kontakt für Beschuldigte von Straftaten im Bereich interpersoneller Gewalt im persönlichen Nahraum
BIG Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt
Rechtsanwälte
Justizvollzugsanstalten und Soziale Dienste der Justiz
Kooperationspartner*innen Deutschland
Kriseninterventionsteam Stalking und häusliche Gewalt, Bremen
Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement, Darmstadt
Informationsplattform zum Thema „Stalking und Justiz“
Initiative Gemeinsam gegen Stalking
InterventionsZentrum Häusliche Gewalt, Südpfalz
Stop-Stalking Süd, Mannheim
Kooperationspartner*innen International
The International Victimology Institute Tilburg, Holland
National Stalking Clinic, London, Großbritannien
National Stalking Helpline, Großbritannien




